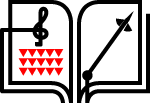In Reih und Glied - Traditionsmärsche der NVA (Folge 1)
| In Reih und Glied | |
| Traditionsmärsche der NVA (Folge 1) | |
 | |
| Interpret: | Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee |
| Plattenfirma: | BARBArossa Musikverlag |
| Erscheinungsdatum: | 2002 |
| Typ: | CD, Album |
| Katalognummer: | EdBa 01357-2 |
| Labelcode (LC): | 04022 |
| EAN Barcode: | 4 019774 135722 |
| Beteiligt: | Cover-Design: Frank Lietz, Foto: Militärhistorisches Museum der Bundeswehr, Vertrieb: Sony Music Import Service, Lizensiert durch das Deutsche Rundfunkarchiv |
Einlegertext
Militärmusik in der DDR
Über 40 Jahre Militärmusik im östlichen Teil Deutschlands, der ehemaligen DDR, sind ein Kapitel Militärmusikgeschichte, das aus der allgemeinen Militärmusikentwicklung nicht ausgeklammert werden kann. Für viele der beteiligten engagierten Militärmusiker waren diese Jahrzehnte ihr wichtigster Lebensabschnitt.
In den Jahren 1946/47/48 wurden die ersten Blasorchester der Polizei in Stärken von 35 bis 40 Musikern gegründet. Die Standorte waren Berlin, Potsdam, Schwerin, Halle, Erfurt und Dresden. Parallel zur Volkspolizei erfolgte 1952 die Bildung der Kasernierten Volkspolizei (KVP) und der Deutschen Grenzpolizei als Vorläufer der späteren Nationalen Volksarmee (NVA). Die Struktur und auch die Dienstgrade hatten im Gegensatz zur Polizei militärischen Charakter.
Als Grundlage für die Besetzungsformen der neu aufgestellten Kapellen/Orchester diente das Muster der damals in der DDR stationierten sowjetischen Militärkapellen. Es wurden 54 Kapellen in folgenden Stärken gebildet:
- 12 Musiker, 1 Offizier an Lehreinrichtungen,
18 Musiker, 1 Offizier bei Bereitschaften (= Regiment),
24 Musiker, 1 Offizieberi den Militärbezirken,
größere Orchester bei den Stäben der Volksmarine, Luftstreitkräfte/Luftverteidigung, Grenzpolizei. Als Repräsentationsorchester entstand in Berlin das Zentrale Orchester der KVP, das spätere Zentrale Orchester der NVA.
Die Gründung der NVA 1956 brachte dann entscheidende Veränderungen für die Militärmusik und damit eine reale Basis für musikalische Entwicklungsmöglichkeiten. Die Orientierung an die Sowjetarmee während der Zeit der KVP wurde durch die Wiedereinführung traditioneller Elemente der deutschen Militärmusik, die sich von der kaiserlichen Armee über Reichswehr bis zur Wehrmacht erhalten hatten, abgelöst. Einige ehemalige Musikmeister, Obermusikmeister und Stabsmusikmeister, die sich schon beim Aufbau der KVP-Musik engagiert und größere Orchester geleitet hatten, wurden in die neue Armee übernommen.
Diese erfahrenen Militärkapellmeister nahmen wesentlichen Einfluß auf die neu zu schaffende Dienstordnung für die Militärmusik (Militärmusikordnung). Es wurden 31 Orchester und ein Spielmannszug aufgestellt. Offiziell führte man die Bezeichnungen „Musikkorps“ (MK) und „Stabmusikkorps“ (SMK) ein. Von den 31 Orchestern wurden bereits 1959 acht MK wieder aufgelöst.
Der Schellenbaum in seiner alten bekannten Form wurde wieder eingeführt. Die Militärmusiker trugen auf den Schulterstücken neben dem Dienstgrad wieder die traditionelle Lyra als Dienstlaufbahnabzeichen (Musiker silberfarben, Offiziere goldfarben). Ebenso erhielten die Musiker wieder die traditionellen Schwalbennester, die später allerdings nur noch an der Paradeuniform getragen wurden. Zu den traditionellen Überlieferungen gehörte auch die unveränderte Übernahme des militärmusikalischen Zeremoniells in allen seinen Formen.
Bis zur Auflösung der NVA 1990 bestanden 23 Orchester und ein Spielmannszug, dazu ab 1976 noch das Orchester der Militärmusikschule Prora/Rügen in folgender Struktur:
- 1 Zentrales Orchester mit 72 Musikern,
5 Stabsmusikkorps mitje 43 Musikern,
17 Musikkorps mitje 28 Musikern,
1 Spielmannszug mit 18 Spielleuten.
Standorte:
- Landstreitkräfte: SMK in Leipzig, MK in Dresden, Erfurt, Halle, Potsdam, Görlitz, Schwerin, Neubrandenburg, Eggesin.
Volksmarine: SMK in Rostock, MK in Stralsund, Warnemünde, Peenemünde, Dranske/ Rügen.
Luftstreitkräfte/ Luftverteidigung: SMK in Cottbus, MK in Kamenz, Trollenhagen.
Grenztruppen: SMK in Erfurt, MK in Plauen, Suhl, Magdeburg.
Stadtkommandantur Berlin: SMK und Spielmannszug.
Der Personalstamm der Orchester bestand überwiegend aus Berufssoldaten (Mindestverpflichtung 10 Jahre) und zu einem geringen Teil aus Zeitsoldaten (Mindestverpflichtung 3 Jahre). Die Aufnahme Wehrpflichtiger war nur in Ausnahmefällen gestattet.
Für die Orchester gab es außer der allgemeinen Militärmusikordnung noch spezielle Vorschriften über Beförderung und Bekleidung. Dadurch hatten die Militärmusiker wesentliche Vorzüge vor den Angehörigen der Truppenteile.
Die Mehrzahl der ehemaligen Musiker der Wehrmacht, die in die KVP und dann in die Armee eingestellt wurden, waren in den früheren Stadtmusikschulen (Stadtpfeifen) ausgebildet worden, Diese Ausbildung war qualitativ sehr unterschiedlich. Mit der Profilierung der Orchester und der Verbesserung der sozialen Bedingungen der Militärmusiker bewarben sich zunehmend Absolventen der damals existierenden Fachschulen für Musik, die eine sehr gute Orchesterausbildung genossen hatten. Das bot die Möglichkeit, das musikalische Niveau der Orchester erheblich zu steigern. Diese Verbesserung der künstlerischen Leistungen der MK/SMK bewog auch Absolventen der Musikhochschulen in die Militärorchester einzutreten. Vor allem im ZO und in den SMK war ab den 70er Jahren der Anteil der Hochschulabsolventen beachtlich hoch. Außerdem wurde es üblich, junge Militärmusiker zu einem externen Studium an eine Musikhochschule zu delegieren.
Im September 1975 wurde die Militärmusikschule als Fachrichtung Militärmusik an der Technischen Schule „Erich Habersaath“ der Armee in Prora/Rügen eröffnet und erhielt den Status einer Fachschule. In einem 3-jährigen, später 4-jährigen Studium wurden pro Studienjahr 30 Militärmusiker ausgebildet. Die Ausbildung der Militärkapellmeister erfolgte ausschließlich durch ein ordentliches Kapellmeisterstudium an den Musikhochschulen. Die Chefdirigenten des ZO und der SMK konnten für hervorragende Leistungen vom Minister für Kultur zum Musikdirektor (MD) und Generalmusikdirektor (GMD) ernannt werden.
In der Anfangszeit waren die Militärorchester nur auf das vorhandene frühere Notenmaterial für Blasorchester angewiesen. Das genügte bald den wachsenden Ansprüchen der Musiker und auch des Publikums nicht mehr. Aus dieser Lage heraus entstanden verhältnismäßig schnell neue Arrangements und nach und nach auch neue Originalkompositionen für Blasorchester.
Einige junge, begabte Militärmusiker qualifizierten sich durch Studium und Praxis zu hervorragenden Arrangeuren. Auch bei Komponisten des zivilen Bereichs wuchs zunehmend das Interesse an niveauvoller Blasmusik. In enger Zusammenarbeit zwischen Komponisten, Arrangeuren und Kapellmeistern entwickelte sich ein fruchtbares Auftragswesen. Die vielen schönen alten Militärmärsche gehörten jedoch fest zum Repertoire der Orchester. Sie wurden oft und gern gespielt. Verboten waren sie nicht, wie manchmal behauptet wird. Unerwünscht blieben lediglich „Preußens Gloria“, der „Badenweiler“ und „Fridericus Rex“.
Die dienstlichen Einsätze der MK/SMK/ZO wurden von den vorgesetzten Dienststellen/Kommandos vorgegeben. Veranstaltungen im zivilen Bereich durchzuführen, lag in der Befugnis der Chefs der Orchester. Für diese Auftritte schloß der Chef des Orchesters Verträge mit dem Veranstalter ab. Von den eingespielten Geldern konnten vierteljährlich 50% als Prämien an die Musiker ausgezahlt werden. Auch damit wurde eine alte Tradition der deutschen Militärmusik wieder eingeführt, das früher übliche sogenannte „gewerbliche Spielen“. Für Einsätze/Veranstaltungen am Wochenende stand den Musikern entsprechende dienstfreie Zeit zu. Die Festlegungen dazu lagen ebenfalls in der Befugnis der Orchesterleiter.
Dienstliche Einsätze innerhalb der Armee:
- Militärische Zeremoniells,
Konzerte in den Truppenteilen mit Estradencharakter,
Konzerte zu festlichen Anlässen,
Gemeinsame Großkonzerte des ZO der NVA, der Sowjet-Armee, der Polnischen Armee, der Tschechoslowakischen Volksarmee, der Rumänischen Volksarmee und der Bulgarischen Volksarmee in Berlin,
Tanzmusik in Dienststellen,
Kammerkonzerte und musikalisch-literarische Veranstaltungen.
Großer Wert wurde der Präsenz der Orchester in der Öffentlichkeit beigemessen. Dadurch erreichten die Orchester große Beliebtheit bei der Bevölkerung. Dazu gehörten die Konzerte an bekannten Ausflugsorten in den Garnisonsstädten wie im Leipziger Zoo, im Berliner Tierpark, auf der Brühlschen Terrasse in Dresden usw.
Weiterhin Betriebskonzerte, Betriebsfeste, Schulkonzerte, Pressefeste, Konzerte zu politischen Feiertagen, Stadt- und Dorffeste, Jugendweihen usw. Mit dem ZO und den SMK produzierten die Sender des Rundfunks zahlreiche Aufnahmen. Die Sendereihe des Fernsehens „Von Polka bis Paradeschritt“ war ausschließlich der Militärmusik vorbehalten.
Die Militärmusik der ehemaligen DDR erreichte ein hohes künstlerisches Niveau und war bei einer großen Vielseitigkeit des Repertoires ein wesentlicher Teil des kulturellen Lebens. Der Marsch als eine Urform der geblasenen und getrommelten Musik hat eine weit zurückreichende Tradition. In seiner Vielfalt hat er in der Militärmusik lange Zeit eine dominierende Stellung eingenommen und wiederspiegelt in einzigartiger Weise eine interessante Seite der Blasmusikentwicklung. Mit der zunehmenden Motorisierung der ehemaligen Fußtruppen verlor der Marsch allmählich seine Bedeutung als Straßenmarsch, als Musik zum Marschieren. Seinen Platz in den Konzertprogrammen der Blasorchester behauptete er jedoch bis heute.
Auch bei der ehemaligen NVA waren nur noch bei militärischen Zeremoniells kurze Marschwege üblich. Gebraucht wurden, je nach ihrem militärischen Charakter, der Marsch zur Meldung an den Kommandeur, der Präsentiermarsch zum Abschreiten der Front der angetretenen Truppen und Parademärsche zum Vorbeimarsch. Die auf dieser CD vorgestellten in Form und Art verschiedenen Märsche sind Kompositionen, die zum festen Repertoire der Orchester der NVA gehörten. Sie reihen sich dadurch in die lange Tradition der Marschmusik ein.
MD Werner Kunath (im Herbst 2002, Leipzig)
Titelliste
| Track | Titel | Komponist | Interpret | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | In Reih und Glied | Alfred Pechau | Zentrales Orchester der NVA
Major Bernd Zivny |
2:13 |
| 2 | Spartakisten | Alfred Lehmann | Zentrales Orchester der NVA
Oberst GMD Gerhard Baumann |
2:59 |
| 3 | Marsch der jungen Revolutionäre | Hans-Helmut Hunger | Zentrales Orchester der NVA
Oberst GMD Gerhard Baumann |
2:41 |
| 4 | Soldatengruß | Lothar Dobberschütz | Stabsmusikkorps der Landstreitkäfte
Oberstleutnant MD Werner Kunath |
2:12 |
| 5 | Neues Leben | Siegmund Goldhammer | Stabsmusikkorps der Landstreitkräfte
Oberstleutnant MD Werner Kunath |
2:40 |
| 6 | Schwarzes Gold | Egon Spangenberg | Zentrales Orchester der NVA
Oberst GMD Heinz Häcker |
2:15 |
| 7 | Jung sind die Linden | Horst Wolf | Stabsmusikkorps der Grenztruppen
Oberstleutnant GMD Hans-Jürgen Rohland |
3:19 |
| 8 | Hand in Hand | Gerhard Thürmer | Stabsmusikkorps der Grenztruppen
Oberstleutnant GMD Hans-Jürgen Rohland |
2:54 |
| 9 | Marsch der Fla-Raketen-Truppen | Wolfgang Leder | Zentrales Orchester der NVA
Oberst GMD Gerhard Baumann |
2:34 |
| 10 | Immer gefechtsbereit | Siegfried Bethmann | Zentrales Orchester der NVA
Oberst GMD Gerhard Baumann |
3:02 |
| 11 | Wir schützen unsre Heimat | Herbert Wiedemann | Stabsmusikkorps der Volksmarine Rostock
Fregattenkapitän MD Walter Hoffmann |
2:30 |
| 12 | Flottenparade | Ludwig Schmidt | Stabsmusikkorps der Volksmarine Rostock
Kapitän zur See MD Ludwig Schmidt |
3:05 |
| 13 | Marsch des Regiments Walter Empacher | Egon Spangenberg | Zentrales Orchester der NVA
Oberst GMD Gerhard Baumann |
1:59 |
| 14 | Oktoberparade | Egon Spangenberg | Zentrales Orchester der NVA
Oberst GMD Heinz Häcker |
2:24 |
| 15 | Junge Piloten | Willy Schade | Stabsmusikkorps der Luftstreitkräfte und Luftverteidigung
Oberstleutnant GMD Horst Hoffmannbeck |
3:35 |
| 16 | Präsentiermarsch der NVA | Alfred Pechau | Orchester der Waffenbrüder
Oberst GMD Heinz Häcker |
2:37 |